Was ist Rassismus?
Ein amerikanischer Apfelkuchen? Eine Mohren-Apotheke? Nein, sagt der Sänger und Journalist Thomas Stimmel. Diese aufgeregte und flache woke Debatte lenke von dem eigentlichen Problem des Rassismus ab. Regierungen und Wirtschaft benachteiligten arme und schwarze Länder systematisch. Frankreich erhebe heute noch Steuern von den ehemaligen Kolonien für die geleistete Infrastruktur.
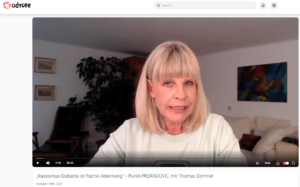
Video anschauen & Quelle Text
__________________
Das ist Rassismus, oder?

Quelle Artikel und PDF*
*Weil das Thema außerordentlich wichtig für die Fragestellung „Die Zukunft Deutschlands“ ist, zitieren wir den als PDF. Verweise, Grafiken und Kommentare lesen Sie, wenn Sie WELTplus testen/abonnieren. Wir empfehlen WELTplus ausdrücklich: 30 Tage kostenlos testen.
[/read]

Da sind natürlich richtige und wichtige Aussagen drin.
Nur eins stört mich massiv: Dass der Interviewte auf das Kindermärchen von der französischen „Infrastruktursteuer“ hereingefallen ist, die Frankreich von den Ex-Kolonien erhebe. Wie sollte ein souveräner Staat von einem anderen „Steuern“ erheben? Die Algerier etc. würden sich doch kaputtlachen über die durchgeknallten Franzosen, wenn die mit einer solchen Zumutung aus dem Irrenhaus zu ihnen kämen!
Das Märchen ist entstanden aufgrund von Fake News eines ‚Guardian‘-Journalisten, der einige Dinge gar nicht und andere falsch verstanden hat (das ist bei ‚Guardian‘-Journalisten allerdings normal). Und dann wurde es von anderen linken Spinnern aufgegriffen.
Die französische Zeitung ‚Le Monde‘ ist traditionell gemässigt links, und traditionell zuverlässig in ihrer Berichterstattung. In ihrem Artikel „Confusions autour d’un ‚impot colonial‘ …“ vom 23.1.2017 wird die Sache aufgedröselt. Es ist nichts dran.
Zum THEMA RASSISMUS und KOLONIALISMUS
RATESPIEL: Von welchem Land ist in folgenden Zitaten die Rede?
»The area that was to become … was heavily forested, sparsely populated, and at the
time American settlers established their settlements, indigenous groups were still migrating into the area and settling there too. In the process, they allied with some
groups already present and got into conflict with others… Reminiscent of pre-state era
Europe, peace and war were not clearly differentiated and among the groups already
present, violent conflict was frequent. Control over trade routes and acquisition of slaves were major motive for warfare…. Political authority was, to a large extent, economically based on intermediary positions in trade between the interior and European
merchants, the most important trade item being slaves. Indigenous political communities tended to be small-scale and dispersed. A situation of intense competition between indigenous groups, accompanied by the incessant conclusion and dissolution of
alliances, formed the background to… efforts at rule until the turn of the century.
When the settlers arrived, local political communities were thus experienced in fighting, establishing purpose-driven alliances, and adapting to shifts in the distribution of
political power…« (S. 15f.).
»About a year and a half after the creation of the colony, the settlers were attacked for
the first time.« (S. 16).
»Until the early 20th century, marriages between settlers and indigenous individuals
were socially unacceptable.«
(S. 22).
»Practices of de facto slavery became a matter of international debate… in 1927…
[An ] investigation revealed that Vice-Presidemt Allen Yancy… played a major role in
organizing slave exports…«
Man hatte Dorfgemeinschaften gezwungen, »boys« als »Arbeitskräfte« zur Verfügung zu stellen, indem man drohte, die Dörfer niederzubrennen oder die Häuptlinge
zu Tode zu foltern.
(S. 30; – Zitate aus F. Gerdes, The Evolution of the… State, Uni. Hamburg, Institut
für Politikwissenschaft 1/2013).
– Jeder linke Antirassist wird natürlich hier wie aus der Pistole geschossen antworten:
es handelt sich um die USA. Auch wenn ihm vielleicht ein Vizepräsident Yancy nicht
bekannt vorkommt. Und die armen unterdrückten Eingeborenen sind natürlich die Indianer. FALSCH!
Es handelt sich um den Staat Liberia, der als Projekt einer privaten Gesellschaft entstand, die im liberianischen Gebiet Land kaufte, damit sich dort ehemalige Sklaven
aus den USA ansiedeln könnten. So entstand im Lauf der Zeit der Staat Liberia.
Allerdings hatte man übersehen, dass es dort schon Einwohner gab – beispielsweise
die Stämme der Kru, Krahn, Mandingo, und viele, viele andere.
Und zwischen den schwarzen Kolonisten und den – ebenfalls schwarzen – Ureinwohnern entwickelten sich sehr bald Konflikte (siehe z.B. die umfassende Darstellung des
schwarzen amerikanischen Soziologen Charles Spurgeon Johnson, Bitter Canaan).
Das Buch erschien erst 1987, obwohl es schon in den 30iger Jahren fertiggestellt worden war.
«… manuscript readers from the black establishment were still reluctant to recommend publication of a book which emphasized that blacks as well as whites could oppress blacks« (R. Robbins, Rezension in ›Social Forces‹, March 1989).
Die liberianische Unabhängigkeitserklärung erklärte Liberia zum »Asyl für free people of color«, die »vorher Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika« gewesen
seien. Auf diese Weise wurden die indigenen Stämme gleich zu Beginn ausgeschlossen; dieser Zustand hielt bis 1946 an« (J.-P. Pham, Liberia – Portrait of a Failed State,
2004, S. 52).
Die Verfassung des Liberianischen Commonwealth von 1839 bestimmte, dass nur
ehemalige Einwohner der Vereinigten Staaten Bürger Liberias seien (ibid.).
Befreite Sklaven, deren Vorfahren ursprünglich nicht aus dem Golf von Guinea
stammten, sondern aus anderen Gegenden Afrikas, wurden bis zum Erwachsenenalter
liberianischen Siedlerfamilien zugewiesen, damit die sie in einem Handwerk oder anderen Fertigkeiten unterwiesen. Ein liberianischer Staatsmann meinte, dass es ein besonderes Statussymbol für eine Siedlerfamilie sei, wenn man viele von diesen fremden »recaptives« oder »Congos« genannten Menschen für sich auf den Feldern arbeiten lassen konnte (ibid.).
Graham Greene bereiste in den 30iger Jahren Liberia und berichtete (in »Journey Without Maps«) wie lokale Beamte mit Hilfe der Miliz Dorfbewohner zu unbezahlten
Arbeiten sowohl für die Gemeinschaft wie auch für Privatleute pressten.
Mit »Arbeitsunwilligen« ging man dabei nicht zimperlich um.
Beliebte Bestrafungsmethoden waren das »Küchenräuchern« und der »Korb Nr. 1«.
Bei der ersten Teufelei hängte man den Delinquenten in einer üblicherweisen fensterlosen Hütte an die Decke und entzündete ein Feuer unter ihm; das Gefühl, langsam zu
ersticken, änderte die Arbeitsauffassung des Delinquenten.
Korb Nr. 1 bestand aus einem sehr grossen, sehr soliden Korb, der typischerweise mit
Erde oder Steinen gefüllt und dann auf dem Kopf des Arbeitsunwilligen platziert wurde – normalerweise braucht man vier Männer, um ihn zu tragen. Die Strafe konnte einem Mann das Genick brechen oder die Wirbelsäule ernsthaft verletzen.
Die harsche Vorgehensweise der Miliz hing wohl auch mit der Angst der Americo-Liberianer vor den einheimischen Stämmen zusammen. Der liberianische Präsident William Tubman (Amtszeit von 1944 bis 1971, er übertraf also sogar Angela Merkel)
gab einmal der Befürchtung Ausdruck, dass der »zivilisierte« Teil der liberianischen
Bevölkerung von der Masse der »halbzivilisierten« überwältigt werden könnte (zit.
nach A. Sawyer, The Emergence of Autocracy in Liberia, 1992, S. 208).
Tubman reiste sogar in die USA und in die Karibik, um »zivilisierte« Schwarze in
grösserer Zahl nach Liberia kommen zu lassen, um das Zahlenverhältnis zu ändern.
Nicht verschwiegen werden soll allerdings die Tatsache, dass sich auch die von Weissen geführte ›Firestone‹-Gesellschaft fleissig an der Unterdrückung und Ausbeutung
der Ureinwohner beteiligte.
Ohnehin hatte der pechschwarze Präsident Tubman ›merkwürdige‹ Ansichten. Bei einem Besuch des amerikanischen Präsidenten Nixon in Monrovia, der Hauptstadt Liberias, sagte Tubman auf Nixons Frage, wie er die Aussichten der abhängigen afrikanischen Länder einschätze: Zweifellos hätten die kolonisierten Völker ein Recht auf
Unabhänigkeit – aber sie sollten auch die Vorteile bedenken, die aus der Verbindung
mit Grossbritannien und Frankreich für ihre Wirtschaften herrührten.
»He said that they [colonized countries] had an enourmous advantage over Liberia,…
since Liberia virtually had to start from scratch and… had to do everything for itself«
(US Department of State, Foreign Relations of the United States, 1955-57, Africa,
vol. XVIII, p. 408 – im Internet lesbar).
Einige Jahre später, 1965, schrieb der Ökonom George Dalton:
»With the partial exception of Ethiopia, Liberia is the only country in Africa which
was never the colony of a European power. It has been a sovereign republic since
1847. For those who are impressed by the favorite myth of African political leaders –
that before European colonization Africa must have enjoyed some sort of golden age,
because its present social and economic problems are the evil legacy of wicked European colonialism – an examination of Liberia is instructive«.
(Dalton, History, Politics and Economic Development in Liberia, in: ›Journal of Economic History‹, 4/1965, p. 572).
– – –
Es ist längst erwiesen, wenn dies auch von linken »Progressiven« gewohnheitsmässig unter den Teppich gekehrt oder kleingeredet wird, dass die Mehrzahl der schwarzen Sklaven keineswegs von Europäern, sondern von benachbarten schwarzen Stämmen oder Arabern versklavt und dann erst an Europäer weiterverkauft wurde.
Portugiesen und andere Europäer waren in Westafrika – dem Hauptschauplatz des
transatlantischen Sklavenhandels – so wenig zahlreich vertreten, dass sie gar nicht in
der Lage gewesen wären, systematisch Sklavenjagden im Inneren des Landes durchzuführen. Das erledigten für sie die einheimischen Stämme (in Gustav Nachtigals Berichten über seine Afrikareisen findet sich eine Passage, in der er Gelegenheit hatte,
eine solche Sklavenjagd unter Nachbarn zu beobachten).
Bekannt ist der Sklavenjäger und -Händler Tippu Tip (siehe englische Wikipedia), der aufgrund seines Handels in Ostafrika zeitweise so etwas wie ein persönliches Herrschaftsgebiet errichten konnte.
Er war so stolz auf seine ›Karriere‹, dass er – wohl als einziger Sklavenjäger – sogar
seine Biographie veröffentlichte (siehe Angela Downing, The autobiogrphy of Hamed bin Muhamed el Murjebi, »Tippu Tip«, in: ›Barcelona English Language and Literature Studies‹, 1989 – 1).
(Für diejenigen unter uns, die kein Suaheli verstehen: Es gibt deutsche und englische
Übersetzungen.)
– – –
Aber wie war das dann aber mit der Kolonisierung Amerikas? Das war doch wohl eine exklusiv weisse Teufelei? Nun, mitnichten! Schon bei Hernan Cortes` bluttriefender Eroberung des mexikanischen Aztekenreichs mischten schwarze Kämpfer mit, und das keineswegs als Sklaven oder Bedienstete, wie manchmal behauptet wird, sondern als freie Conquistadoren.
Der Fall des Juan Garrido ist der bekannteste. Garrido kam zwar als Sklave aus Afrika nach Lissabon, wurde aber bald schon freigelassen, fuhr nach dem neuentdeckten Amerika und beteiligte sich dort an der Eroberung von Santo Domingo (1502), und später an denen von Puerto Rico und Kuba. 1519 schloss er sich Cortes´ Expeditionskorps nach Mexiko an. Dort beteiligte er sich an den Kämpfen
um Tenochtitlan (Mexico City), erwarb Land und war aller Wahrscheinlichkeit nach
der erste Mensch, der Weizen in der neuen Welt anbaute.
Garrido war keineswegs ein Einzelfall. Die spanische Wikipedia gibt unter dem Eintrag ›Juan Garrido‹ Literatur (auch in Englisch) über andere schwarze Conquistadoren an; wer Spanisch lesen kann, ist bei dem Aufsatz von Juan Sanchez: Juan Garrido – el negro conquistador, in: ›Hipogrifo‹, 1/2020, gut aufgehoben.
Wir wissen, dass Cortes Mexico niemals ohne einheimische Verbündete hätte erobern können. Die Azteken hatten ja andere indianische Völker um sich herum grausam unterdrückt. Die Tlaxcalteken etwa ergriffen nach anfänglichem Zögern die Gelegenheit, sich mit den spanischen Eindringlingen gegen ihre aztekischen Herren zu
verbünden und schlossen sich deren Marsch auf Mexico City an. Wegen ihrer Hilfe
erhielten sie später von den Spaniern Privilegien und gründeten sogar im Nordosten
Mexikos und im heutigen südwestlichen Texas eigene Kolonien (näheres über die
Tlaxcalteken bei John Schmal, Indigenous Tlaxcala, in: ›Indigenous Mexico.org‘, Sept. 2019.
Und wie verhielt es sich mit der Sklaverei in den USA? Nun, auch da gibt es Details,
die geeignet sind, jedem Linksprogressiven peinlich aufzustossen.
Frederick Olmsted war im 19. Jahrhundert so etwas wie der Vater der amerikanischen
Landschaftsarchitektur – in den 1850iger Jahren bereiste er den Süden der USA,
sprach mit Plantagenbesitzern, Sklaven und vielen anderen und berichtete später in
zwei Bänden darüber. Unter anderem berichtet er von einem Gespräch mit einem
Sklaven in Louisiana:
«… He pointed out to me three plantations, within twenty miles, owned by coloured
men. These bought black folks, he said, and had servants of their own. They were
very bad masters, very hard…«:
“ You might think master, dat dey would be good to dar own nation but dey is not… If
I was sold to a brack man, I’d drown myself. I would dat I’d drown myself! dough I
shouldn’t like to do dat nudder ; but I wouldn’t be sold to a coloured master for any
ting… The French masters were very severe, and dey whip dar niggers most to deff
dey whip de flesh off of ‚em“
(F. Olmsted, The Cotton Kingdom of America, vol I, 1861; pp. 336).
An anderer Stelle zitiert Olmsted eine Stimme, wonach die schwarzen Plantagenbesitzer ihre Sklaven nicht so hart arbeiten liessen wie die weissen, sie würden sie aber
schlechter ernähren und kleiden.
Und der Besitz von schwarzen Sklaven durch freie Schwarze war keineswegs eine
auf Louisiana beschränkte oder im 19. Jahrhundert neue Sache. Anthony Johnson
(circa 1600 – 1670) war ein schwarzer Angolaner, der in Virginia zu grossem Wohlstand gelangte und der in Erinnerung geblieben ist durch ein bemerkenswertes Gerichtsverfahren. Johnson war in seiner Jugend selbst ein sogenannter »indentured servant« gewesen, ein Arbeiter, der durch Kontrakt, meist über mehrere Jahre gehend,
gebunden war, ohne Lohn für eine andere Person zu arbeiten (oft zahlte man auf diese
Weise Schulden ab). 1656 befand ein Gericht in Northampton County, Virginia, dass
der schwarze Arbeiter John Casor sich unrechtmässig aus Johnsons Kontrakt-Dienst
entfernt hatte und Casor – ein Schwarzer deshalb Johnson lebenslang unentgeltlich zu
Diensten sein müsse. Praktisch war das Sklaverei.
In Casors Fall hatten zwar zwei weisse Farmer bestätigt, dass Casors Kontrakt mit
Johnson abgelaufen gewesen war – aber das Gericht glaubte in zweiter Instanz Johnson (s. Herbert Klein, Slavery in the Americas, 1988, pp. 43).
Das Problem des Besitzes von schwarzen Sklaven durch andere Schwarze wird u.a.
abgehandelt in:
Henry L. Gates, Did black people own slaves?, in: ›The Root‹, 3.04.13;
C. Adams, A peculiar institution within the peculiar institution: an examination of affluent black slave owners in the third caste, in: ’Journal of Interdisciplinary Undergraduate Research‘, vol. 8, 2016.
A. Ulentin, Free women of color and slaveholding in New Orleans, 1810-1830.
Louisiana State Master’s Thesis, 2007;
[ laut anderer Experten soll es Mitte des 19. Jahrhunderts allein in und um New Orleans an die 3000 schwarze Sklavenbesitzer gegeben haben.]
– – –
Dies alles wäre noch in aller Breite weiter ausführbar, viele andere Aspekte könnten
noch aufgelistet werden, aber es soll ja eine Collage sein, keineswegs eine umfassende Darstellung.
Bedeuten die aufgeführten Fakten eine Relativierung weissen Unrechts an Schwarzen? Nein. Schon allein aus dem Grund nicht, weil Linksprogrssive bei der Nennung
solcher Fakten stets sagen, mit solchen Argumenten wolle man weisses Unrecht relativieren. Und das ginge nun wirklich nicht.
Wer bin ich denn, dass ich solchen ausgewiesenen moralischen Autoritäten wie unseren Linksprogressiven widersprechen dürfte? Niemals würde ich das wagen!
Aber wenn wir Weissen schon vor dem Gericht der Linken stehen, dann soll uns auch
eine Verteidigung zugestanden werden wie vor Gericht. Wir müssen Fakten nennen
dürfen, die die das allgemeine Lagebild so darstellen, dass unsere schreckliche Erbsünde in einem weniger exzeptionellen Licht erscheint. Viele andere waren auch keine Engel, wir waren nicht allein! Manchmal verwischen sich sogar, wie an einigen
wenigen Beispielen dargestellt, die Grenzen zwischen Tätern und Opfern.
Bedenken müssen wir auch: Gelegenheit schafft Diebe! Europäer waren zahlreich
und auf jeden Fall seit etwa dem 16. Jahrhundert allen anderen Völkern technisch
überlegen. Was wäre denn gewesen, wenn die grönländischen Eskimos, pardon, Inuit,
oder die friedliebenden südafrikanischen Zulus unsere Anzahl und unseren technologischen Stand gehabt hätten? Dann hätten diese vielleicht Kolonialreiche errichtet?
Und während langandauernder Epochen der Menscheitsgeschichte war das, was wir
getan haben, im Vergleich und in den Augen von nicht-weissen Zeitgenossen keineswegs monströs, sondern sogar normal. Um wie viel mehr durfte es dann damals in unseren eigenen Augen normal gewirkt haben?
Es fehlte in diesen dunklen vergangenen Zeiten einfach an einer genügend grossen
Zahl von Linksprogressiven, die uns, wie sie das heute dankenswerterweise täglich
auf allen Kanälen tun, die Leviten gelesen hätten. Dann wären wir – oder unsere
Grossväter – damals sicherlich in uns gegangen und hätten Abstand von unseren
schrecklichen Sünden genommen.
Aber zum Glück wissen wir ja heute, was wir an unseren lieben neunmalklugen Linksproggressiven haben, die uns täglich bepredigen. Ewig währe unser Dank!